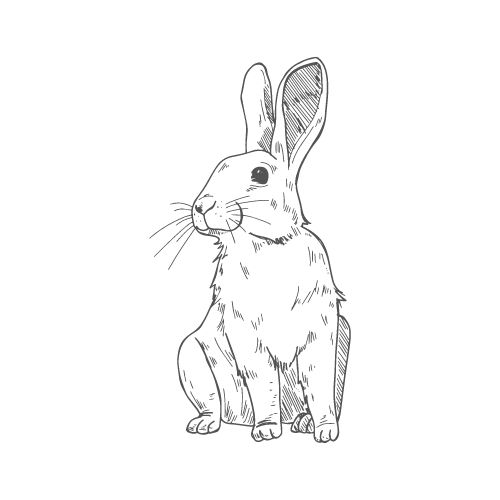[Massive Spoiler voraus (auch das Buch betreffend)]
Schon im Titel und im Namen der Hauptfigur Patrick Bateman klingt an, was in der Geschichte verfolgt wird. Eine Art Sittengemälde der spezifisch amerikanischen Art des Psychopathen, die den noch vereinzelten Psychopathen Norman Bates aus Hitchcocks 50er-Jahre-Klassiker Psycho längst übertrifft und auf so häufige Art reproduziert, dass gleichzeitig die Frage nach der Verstrickung des amerikanischen Traums in diesen Sittenverfall aufgeworfen wird. Was für ein Satz. Sauerstoffmaske anlegen. Es geht los.
Dialektik des Individualismus
In diesem New York zählt das Eierschalenweiß der Kreditkarte und die Art, wie man die Weste unter dem Sakko trägt, mehr als das eigene Gesicht. Wer man ist, ist unbedeutend. Nur vor dem Hintergrund dessen, was man hat (eine Reservierung im hippsten Restaurant der Stadt etwa), erhebt sich so etwas wie eine Sinnhaftigkeit der eigenen Existenz. Natürlich führt gerade diese Moral direkt in die Beliebigkeit der beteiligten Personen. Und so ist es kein Wunder, dass niemand die sich anhäufenden Opfer Batemans zu vermissen scheint. Was mit Morden an Obdachlosen und Prostituierten beginnt, nach denen ohnehin niemand fragt, entwickelt sich zu freimütigen Morden an Kollegen und Ex-Freundinnen. Doch die Grenze, die Bateman hier unter zunehmendem Kontrollverlust zu überschreiten scheint, löst sich auf in der Identitätslosigkeit auch dieser gut situierten, vermeintlich integrierten (worin?, dröhnt es) Opfer seiner Gewaltexzesse. Die Konsumgesellschaft dieses Melting Pots der übleren Sorte verschluckt das Individuum.
Realität ohne Subjekte
Ein Privatdetektiv (Willem Dafoe) findet zwar den Weg in Batemans (Christian Bale) Büro, doch seine Ermittlungen geraten bald ins Stocken, als der vermisste Wall-Street Broker in London gesehen wird – oder auch nicht. Selbst Batemans Anwalt, dem dieser ein ohrenbetäubendes Geständnis aufs Band spricht, amüsiert sich über den vermeintlichen Mordfall. Er habe doch vor zwei Wochen mit Paul in London zu Mittag gegessen, was soll das Ganze? Batemans Verbindung zur Realität wird zunehmend in Frage gestellt. Hat er vielleicht den Falschen ermordet? Sich in der Adresse geirrt?
Das ist einerseits irre komisch und andererseits eine beißende Pointe. Die Wahrheit und mit ihr das Rechtssystem bestehend aus Ermittlern und Anwälten hat keinen Platz in einer Welt ohne Subjekte. Genau solch eine Welt zeigt der Film aber. Eine Welt voller hypermaskuliner Kleiderständer, die sich morgens ihre Gesichtsmasken von den Augen pulen, darunter aber nicht entscheidend Menschlicheres zum Vorschein bringen.
Identität nur jenseits der Extreme
American Psycho ist daher ein Film über Identität, der nach den kleinen Unterschieden fragt, die für gewöhnlich aufgeblasen herausgestellt werden: Hier die Guten, dort die Bösen, da der karriereorientierte Wall-Street Yuppie, hier der kaltblütige Serienmörder. Dort, wo sich die Geschehnisse von American Psycho ereignen, sind diese Unterschiede längst nivelliert. Die Unterscheidung zwischen den mit allerlei nichtssagenden Konsumgütern ausstaffierten Individuen fällt so schwer, dass der Begriff Individuum selbst auf die Probe gestellt wird. Am unteren Ende der Hierarchie sind die Individuen wiederum derart vom Entzug von jeglichem Konsum gezeichnet, dass auch hier eine Unkenntlichkeit Einzug hält, die es nicht erlaubt, den einen Obdachlosen vom anderen zu unterscheiden.
Irgendwo zwischen diesen beiden Extremen scheint eine Mitte zu liegen, die den zweifelsohne nötigen Konsum zum Erhalt des eigenen Lebens und der eigenen Distinktion zulässt, jedoch nicht in die völlige Selbstauflösung führt, in der man selbst nur noch Konsumgut ist. Gleich einem Soldaten, der nichts weiter als die an seiner Brust hängenden Abzeichen mehr darstellt, also Kanonenfutter oder General ist, in völliger Ignoranz gegenüber seiner Menschlichkeit. Doch in American Psycho fehlen Figuren dieser gemäßigten Mitte. Einzig der Privatdetektiv, der Bateman aufgrund des rätselhaften Verschwindens seines Kollegen ins Visier nimmt, scheint die normale Bevölkerung zu repräsentieren. Allerdings dauert es nicht lange, bis auch er die Orientierung verliert und selbst nicht mehr weiß, ob der Gesuchte nun noch lebt oder nicht.
Konsum bis in den Kannibalismus
Batemans Gewaltexzesse werden dabei im gleichnamigen Buch ebenso detailliert beschrieben wie die Outfits der Kollegen oder das Essen im Restaurant. Der Unterschied zwischen diesen Tätigkeiten ist also bloß ein gradueller, und letztlich nicht einmal mehr das. Als Bateman beginnt, die Leichen zu essen, sie also wortwörtlich als Konsumgut zu begreifen, erreicht das Geschehen sein Höchstmaß an Ekel. Gleichzeitig verschwimmen die Grenzen zwischen täglicher Arbeit und nächtlicher Triebauslebung zusehends. Im Buch fällt sogar manches Mittagessen zugunsten eines Leichenschmauses aus. Der Film hält sich hier etwas zurück und beschränkt sich auf die spätere Offenbarung von Batemans Taten (in einer schönen Reminiszenz an The Texas Chainsaw Massacre).
Dieser Kannibalismus ist nur die logische Folge einer vollständigen Konsumorientierung, die das Gegenüber zunächst beim Geschlechtsverkehr als bloßes Mittel zur eigenen Befriedigung begreift und schließlich in aller Konsequenz auch nichts moralisch Falsches oder gar (noch wahnwitziger) Abstoßendes mehr daran finden kann, den Körper des Anderen zu verspeisen.
Heilig ist nur der Konsument
Das einzige Tabu, das Bateman aufrechterhält, ist jenes, das die eigene Aufmerksamkeit nach innen richtet und damit den Verzehr behindert: der Selbstkonsum. Trotz aller Psychosen und Wahnvorstellungen (ein Geldautomat fordert Bateman auf, ihn mit einer streunenden Katze zu füttern) beginnt Bateman nie, sich selbst zu verletzen oder zu bestrafen. Sogar die Selbstbefriedigung ist an den Beginn der Handlung gesetzt und geht in der Folge über in zur Masturbation verkommenem Sex. Die Pornos, die Bateman in der Videothek ausleiht, sind schnell nur noch Anschauungsunterricht, mit dem er seine in die Tat umzusetzenden Fantasien beflügelt. Dieses Tabu dient der Erhaltung des eigenen Egos, dem Konsum darf nicht der Konsument wegbrechen, geschweige denn ein Reflexionsprozess bei diesem einsetzen – ganz wie im echten Leben.
Beziehungen – mit wem denn?
Die Unfähigkeit, tiefergehende Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen, reiht sich in dieses Schema ein. Bateman kann die Menschen nicht losgelöst von ihrem Gebrauchswert betrachten, ob tatsächlich oder nur zur Schau gestellt. Dieses Be- und Verurteilen der Menschen in seiner Umgebung macht es ihm unmöglich, sie als das zu betrachten, was sie jeweils sind. Nur zufällig fallen seine Urteile mit dem Wesen der Leute zusammen („Dieses selbstgefällige Arschloch“), die er größtenteils entweder verabscheut oder für gnadenlos langweilig hält (insbesondere Frauen).
Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie es Bateman auch gelingen sollte, mit Menschen seines Schlags ernsthafte Beziehungen zu führen, die selbst keine Subjekte mehr darstellen. Allein seine Sekretärin Jean, die qua sozialem Status schon einer anderen Spezies angehört, scheint so etwas wie genuine Zuneigung für Patrick zu empfinden, also tatsächlich dem Subjekt Patrick Bateman näher kommen zu wollen. Was wiederrum nicht für sie spricht. Denn ein Subjekt Bateman gibt es für die Mitwelt eigentlich nicht, sondern nur dessen Visitenkarte, seine Anzüge und seinen makellosen Teint. Patrick selbst scheint das zu spüren, weshalb er von dem eigentlich an ihr geplanten Mord absieht und sie als Einzige unbehelligt aus seiner Wohnung entlässt. Das wirft die Frage auf, ob er überhaupt ein Mörder ist, verschont er doch das einzige Individuum, das ihm begegnet. Tötet er nur Nicht-Subjekte, wo sind dann die Opfer?
Alles nur ein Traum?
Am Ende versucht Bateman, sich einer gerechten Strafe auszusetzen. Zu diesem Zweck läuft er zunächst in den nächtlichen Straßen New Yorks Amok und spricht dann seinem Anwalt ein Geständnis auf Band. Doch Bateman muss feststellen, dass ihm keiner glaubt. Mehr noch, seine Verbrechen verfangen nicht in der Realität, sie geschehen, werden aber von niemandem zu Kenntnis genommen. Selbst das Appartement seines Kollegen, in dem er diesen hingerichtet hat, wird längst neu vermietet, und ein Paul Allen soll dort nie gewohnt haben. Für einen Moment stellt sich die Frage, ob Bateman all das nicht nur geträumt hat.
Doch welchen Unterschied würde das machen? Die Realität, an der Bateman sich orientiert, ist längst in Auflösung begriffen. Bar jeder Subjekte und einer von ihnen konstruierten Wirklichkeit wäre das Morden nicht einmal dann unstrittig, wenn Leichen präsentiert werden könnten. Diese Buch wie Film seit Erscheinen begleitende Frage kann daher nicht kriminalistisch lauten: Lebt Paul Allen oder nicht? Sondern: Gibt es ihn?
Takeaways
- Nimm etwas, und steigere es bis in seine absurdesten Konsequenzen hinein. Dann schreib sie auf.
- Wenn du über die fatalen Folgen von X schreibst, suche nach einem damit verwandten Tabu – und brich es
- Die Realität deiner Geschichte hängt von ihren Protagonisten ab, nicht von der unseren
- Um Beziehungen wirkungsvoll zu schildern, musst du zuerst beeindruckende Subjekte schaffen